
Eine andere Denke
Lassen sich klassische deutsche Designwerte wie Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Funktionalität und ein systematischer Ansatz auf das digitale Produktdesign übertragen? Spielt die Nationalität in der digitalen Äraüberhaupt noch eine Rolle? Über diese und andere Fragen diskutiert der designreport mit Christian Hanke, Kreativdirektor bei Edenspiekermann, und Philipp Thesen, Leiter Design der Deutschen Telekom.
Designreport: Ich denke, jeder hat eine Vorstellung davon, was deutsches Produktdesign ist. Sofort fallen einem Klassikermarken wie Braun oder BMW ein. Wir sind hier bei einem Unternehmen zu Gast, das schwerpunktmäßig Serviceleistungen anbietet. Philipp, werden die Telekom-Produkte im Ausland überhaupt als deutsch wahrgenommen?
Philipp Thesen: Das ist ganz unterschiedlich. Deutsches Design ist ja international sehr positiv konnotiert. Vor einigen Jahren, als wir die Designsprache der Telekom-Produkte, auch unserer gesamten Digital Experience, definiert haben, stand die Frage im Raum, ob es dabei spezifisch deutsche Aspekte gibt. Wir sind ein Unternehmen, das seine Produkte in 30 Ländern vertreibt, zu dessen Markenidentität es aber auch gehört, ursprünglich aus Deutschland zu kommen. Ich hatte schon immer ein Interesse an deutschem Design und muss zugeben, dass ich lange Zeit dachte, ein gewisser Ulmer Funktionalismus wäre global üblich. Mein Studium im Ausland hat mir dann gezeigt, dass das nicht überall so verstanden wird.. Internationale Designer schätzen das grundsätzlich Systemhafte, das Nachhaltigkeitsdenken und ein Qualitätsanspruch, der nicht als Luxus verstanden wird, als deutsche Attribute –diese Werte haben durch den internationalen Einfluss der Ulmer Hochschule durchaus etwas Universelles bekommen.
Christian Hanke: Als wir 2015 unser Büro in Los Angeles eröffnet haben, war es ein wichtiges Verkaufsargument, dass wir eine europäische beziehungsweise deutsche Agentur sind – wie ein Gütesiegel. Das liegt aber auch daran, dass Erik (Spiekermann), der als Designer eben diese klassischen Attribute vertritt, dort sehr bekannt ist.
Thesen: Andererseits gibt es viele profilierte Designer aus Deutschland, die hinter ihren Arbeiten verschwinden, anders als beispielsweise in Italien oder Frankreich.
Hanke: Findest Du, dass das etwas Deutsches ist?
Thesen: Ich weiß nicht, aber ich habe in Mailand und Helsinki studiert. In Italien betreiben die Designer einen gewissen Personenkult, in Skandinavien nehmen sich die Leute zwar sehr zurück, aber auch da ist das Autorendesign wichtiger als bei uns. Hier wie dort gibt es starke Design-Unternehmen, deren Ursprung im Handwerklichen liegen. In Deutschland sind die Design-Hochburen eher in der Industrie zu finden und erst neuerdings fängt es an, dass Chief Design Officers wie Gorden Wagener von Mercedes-Benz auch endlich in der Öffentlichkeit präsent sind. Oft ist der deutsche Designer aber immer noch ein dienender, unsichtbarer Geist, der Dinge entwirft, die international gern benutzt werden, deren Autorenschaft aber eher im Verborgenen bleibt.
Designreport: In welcher Form sind denn die Designqualitäten, die ihr, Philipp, damals für euch als typisch deutsch herausgearbeitet habt, in die digitalen Produkte der Telekom übersetzt worden. Lässt sich das konkretisieren?
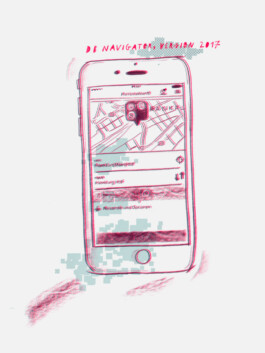
Thesen: Wir haben schon ganz früh sehr funktional gedacht. Man muss dabei sehen, dass sich die Erkenntnis, dass das Thema Digital Experience vor allem auch Hardware-Software-Serviceinnovationen betrifft, in der Breite erst seit ein paar Jahren durchsetzt. Vorher ging es im Digitalen in erster Linie um Websites und Apps, um Entertainment. Und das Funktionale waren oft eher funktionalistische Zitate, wie anfangs bei den Oberflächen von Apple-Produkten, die stilistisch zwar an Dieter Rams erinnerten aber noch gar nicht in dessen Sinne gestaltet waren.
Designreport: Das Klassikerbeispiel: der Taschenrechner von Dietrich Lubs, dessen Optik einfach kopiert wurde ... Das hat doch sicher auch damit zu tun, dass digitale Produkte naturgemäß weniger greifbar sind als Hardware-Produkte, oder?
Hanke: Ist das wirklich so? Ich glaube, wir mussten über die Jahre nur erst einmal lernen, was eine digitale Haptik oder eine digitale Materialität ist. Wir waren anfangs einfach noch unbeholfen.
Thesen: Genau das meine ich. Hinter diesen Zitaten steckte ja auch eine gewisse Hilflosigkeit.
Hanke: Beziehungsweise die Notwendigkeit, für den Nutzer eine Brücke zu schlagen. Darum sind Icons wie die Diskette als Symbol fürs Speichern entstanden. Mittlerweile ist das alles nicht mehr neu und wir können reifer gestalten.
Thesen: Das Digitale ist ja ein völlig neuer Erfahrungsraum, auch im wortwörtlichen Sinne. Es ist kein Zufall, dass die meisten digitalen Anwendungen zu Beginn eher von Industriedesignern gemacht wurden. Auch wir haben vor 10 Jahren erst mal vor allem Industriedesigner eingestellt, weil die räumlicher denken können und sich damit besser in Navigationsstrukturen bewegen können. Damit hatten Grafikdesigner früher erst mal Schwierigkeiten, die waren mehr auf die Oberfläche konzentriert.
Designreport: Auch die Bedeutung von Designklassikern lässt sich mit Unsicherheit in Verbindung bringen: Wenn Verbraucher nicht genau wissen, was gut ist, greifen sie auf Klassiker zurück. Lässt sich das auf das Digitale übertragen? Kann Bewährtes zum Designklassiker werden?
Hanke: Nein, die Denke ist anders. Sicherlich gibt es Metaphern oder auch eine bestimmte Ästhetik, die einen entsprechenden Zeitgeist ausstrahlt. Wikipedia zum Beispiel wird im Großen und Ganzen wohl immer so bleiben, wie es ist. Aber wird es deswegen zum Designklassiker? Oder gehören solche Seiten ins Museum?
Thesen: Nein, außer vielleicht die erste Spiegel-Online-Seite! (Lachen) Aber genau das ist ein wichtiger Punkt: Die Digitalität verändert das Verhältnis des Designers zu seinem Werk und damit sein Selbstverständnis fundamental. Lange Zeit haben Designer davon geträumt, Dinge zu entwerfen, die im Museum landen, die ihr eigenes Leben überdauern – als Ikonen für die Nachwelt eben. Das kann es bei Produkten, die man aufgrund von Nutzeranalysen und Iterationen gefühlte 600 mal am Tag relauncht, nicht geben. Selbst wenn man bestimmte digitale Anwendungen im Kontext ihrer Zeit als herausragend beurteilen kann.
Hanke: IOS 1, das ist auch so eine Zeitkapsel!
Thesen: Ja, oder wichtige Paradigmenwechsel wie Apple’s Lisa – die Geburtsstunde des Graphical User Interface! Aber niemand würde darauf aus Unsicherheit zurückgreifen wollen, so wie man etwa einen Eames Chair kauft, weil man damit nichts falsch machen kann. Vielleicht tritt das digitale Design in die Fußstapfen des unsichtbaren Industriedesigners.

Hanke: Ein bisschen anders ist das vielleicht im digitalen Editorial Design, weil es dort, wo es ums Erzählen geht, expressiver zugehen darf. Von so etwas wie „experimenteller Navigation“ zu reden, ist allerdings Schwachsinn. Das liest man vielleicht in Bachelor-Arbeiten, aber ansonsten muss man sich schon fragen, wo bitte genau dafür die Nische sein soll! (Lachen)
Designreport: Gibt es dann vielleicht bestimmte Gestaltungsprinzipien, die sich im Digitalen zu so etwas wie Klassikern entwickelt haben?
Hanke: Auf jeden Fall. Es gibt einige sehr mächtige Konventionen. Ich erkenne das, wenn meine Kinder versuchen, gedruckte Bilder mit dem Zeigefinger wegzuwischen oder das Stichwort für die Aktivierung von Alexa in ihre Witze einzubauen. Die Streichbewegung wurde für das Palm OS entwickelt und galt in Form von "Streichen zum Entsperren" sogar als markenbildendes Muster für iOS - bis eine neue Technologie aufkam und Apple-Benutzer aus der Gewohnheit herauskamen. So schaffen es die nativen Plattformen, erfolgreiche Produkte und große Designsysteme wie Google's Material Design, weiterhin eine so einflussreiche Rolle im digitalen Design zu spielen.
Thesen: Und das wird weitergehen, vieles wird dazukommen. Es wird neue Interaktionsformen geben – Sprache, Gesten, Predictive Interfaces, die für die User Experience immer wichtiger werden. Und auch da werden sich wieder Klassiker herausbilden.
Designreport: Kann man sich in einem so beweglichen Umfeld überhaupt vorstellen, dass jemand mal zehn Pflöcke einhaut und so wie Dieter Rams mit zehn Thesen festlegt, was gut ist?
Hanke: Aber diese Thesen beziehen sich ja nicht auf einen spezifischen Designbereich!
Thesen: Es geht dabei doch vielmehr um einen Berufsethos, um eine Haltung.
Hanke: Und es steckt einiges drin, was ziemlich deutsch ist. Ich habe im Vorfeld ein paar nichtdeutsche Kollegen nach ihren Vorstellungen von deutschem Design gefragt. In der Hoffnung, ein paar Antworten jenseits der üblichen Klischees zu finden.
Thesen: Klischees sind ja auch nur verdichtete Information ...
Hanke (lacht): Genau! Eine Kollegin aus Slowenien meinte: Germanness is scheduled fun. Aber als Qualität! Ein anderer Kollege sagte, Künstler und Ingenieur in einer Person zu sein, wäre typisch. So ähnlich hat es auch Erik mal für unsere Agentur ausgedrückt: Wir wollen Dinge machen, die nützlich und schön sind, nie nur nützlich und nie nur schön.
Designreport: Aber nichtsdestotrotz unterschieden sich doch die Designprozesse im Digitalen beispielsweise von denen im klassischem Produktdesign. Von einem Stuhl gibt es ein halbes Jahr später kein neues Update, das ist ein abgeschlossenes Produkt.
Thesen: Wenn man aber an die Möglichkeiten von Technologien wie 3-D-Druck denkt, sieht das vielleicht schon anders aus. Durch die Digitalisierung wird die Produktwelt komplexer und immer individueller, deswegen ist das Thema Designmethoden und -prozesse, das seinen Ursprung mal im Technologie-Boom der 1960er Jahre hatte, zur Zeit ja auch wieder so aktuell.
Hanke: Im Vergleich zwischen Print- und Online-Journalismus spricht man von finiten und infiniten Produkten. Die einen denken in Deadlines, für die anderen fängt die Arbeit nach Veröffentlichung erst richtig an – dann wenn die Menschen sich einbringen, mitreden wollen.
Designreport: So offen zu arbeiten, erfordert von Produktdesignern ein großes Umdenken.
Thesen: Das ist eine Frage der Motivation, die hinter der Arbeit steckt. Es gibt explorative Designer, die die Welt erschließen wollen, und andere, die festlegen wollen, wie die Welt zu sein hat. Das sind zumindest zwei Archetypen, die mir immer wieder begegnen. (Lachen)
Designreport: Auch eine gewisse »Ich weiß, was gut für dich ist«-Haltung gilt gern als typisch deutsch. Wie sieht das im UX-Design aus?
Hanke: Autoritäres Design? Funktioniert da nicht oder wird einfach als schlechtes Design wahrgenommen.
Thesen: Im UX-Design steht der Nutzer im Mittelpunkt. Designer sind hier eher Moderatoren zwischen Lebenswelt und Technologie. Mit einem autoritären Gestus kommt man da nicht weit.
Designreport: Wie passt dann dazu, dass Deutschland ausgerechnet in Sachen Service-Design als Spätzünder gilt?
Thesen: Also ich empfinde Deutschland überhaupt nicht als Servicewüste. Ich kenne nicht wenige Leute im europäischen Ausland, die die App der Deutschen Bahn nutzen, um Zugverbindungen im eigenen Land herauszusuchen – weil die so zuverlässig ist. Und es gibt viele solcher Beispiele für hervorragendes Service-Design aus Deutschland.
Hanke: Ich glaube, diese Wahrnehmung hat viel mit dem sehr deutschen Bedürfnis zu tun, alles zu kritisieren. Wenn wir ein digitales Produkt verändern, das viele benutzen, wird grundsätzlich erst einmal gemeckert. Beim Relaunch der NZZ in der Schweiz standen in den Kommentare eher Sätze wie: Klasse, das Blau sieht so wertig aus. Das ist Schweizer Präzision!
Thesen: Und das Thema Servicewüste ist doch auch eins aus den 90ern.
Hanke: Der Begriff hat etwas mit den damaligen behördenähnlichen Strukturen zu tun, mit Monopolstellung – man musste sich nicht so schnell dem Wettbewerb stellen. Viel interessanter ist es aber in die Zukunft zu schauen und zu fragen, was sich daraus lernen lässt. Werden Rückschlüsse gezogen? Hilft das die Angebote zu verbessern? Viel ließe sich schon verändern, wenn die Unternehmen konsequenter die Menschen in die Entstehungsprozesse einbeziehen würden, die bei ihnen mit den Nutzern der Produkte im Kontakt stehen. Partizipation: Wenn man mehr mit den Leuten und nicht über sie hinweg gestalten würde, müssten wir über das Thema Servicewüste nicht länger reden.

Krautter, Martin: Eine andere Denke
designreport, Ausgabe 6/2017 (S. 48 – 52)
Thesen: Das Design muss da noch viel stärker eine vermittelnde Rolle zwischen Mensch, Technologie und Business-Interessen einnehmen. Das setzt voraus, dass sie sich interdisziplinär aufstellt und über ein reiches vielfältiges kulturelles Wissen verfügt. Da stößt der deutsche Horizont sehr schnell an seine Grenzen.
Designreport: Stichwort Designthinking – wie kompatibel ist die Methodik mit deutschen Unternehmenskulturen?
Hanke: Wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal eine Art Heureka-Moment, als mich jemand in diesem Zusammenhang an Maslow und seine Bedürfnispyramide erinnerte. Erst an der Spitze der Pyramide geht es um Selbstverwirklichung. Das heißt solange ein Mitarbeiter nicht weiß, wie sicher sein Job ist, welche Rolle er in der Organisation hat, nie die Erfahrung gemacht hat, gemeinsam mit Kollegen etwas zu bewirken, solange also die sogenannten Defizitbedürfnisse nicht erfüllt sind, wird er auch nicht über Innovationen nachdenken können. Da braucht man dann auch keine Workshops mit bunten Post-its zu machen. Das funktioniert nicht.
Designreport: Gut, aber das ist jetzt kein spezifisch deutsches Problem. Oder ist das vielleicht ein Problem des Mittelstands, der ja hierzulande besonders stark ist?
Thesen: Es geht eher um die Frage, wie professionell mit dem Thema Innovation umgegangen wird, und auch wie wirkmächtig das Design in einer Organisation ist. Diese Arbeit kostet viel Geld und Kraft, darüber muss man sich im Klaren sein. Sich über Design und Innovationen Gedanken zu machen, ist für niemanden in der Organisation ein Hobby, das macht keiner nebenbei.
Designreport: Muss eurer Meinung nach der Mittelstand in Deutschland digitaler werden?
Hanke: Nein. Jeder muss für sich klären, wo die Geschäftsfelder der Zukunft liegen und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass man in zwei Betriebssystem gleichzeitig denken muss. Kein Unternehmen kann es sich leisten, von einem zum anderen Moment nur noch Digitales zu machen, was auch immer das heißen mag.
Thesen: Auch Innovationen lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen einführen. Bei einem Unternehmen wie der Telekom ist es ein großes Risiko IT-Strukturen einfach umzugestalten, mit Geschäftsmodellen oder Tarifen zu experimentieren. Da geht es um Milliardenbeträge. Das ist ein grundsätzliches Problem großer Strukturen, das aber langfristig gelöst werden muss. Die einzige Antwort auf disruptive Geschäftsmodelle wie Uber etc. ist es, selbst überzeugende Angebote zu schaffen.
Designreport: Gibt es international erfolgreiche Digitalprodukte, die als deutsch wahrgenommen werden?
Thesen: Wenn Apps oder andere digitale Produkte erfolgreich sind, spielt es keine Rolle, ob sie aus Tel Aviv, Mountain View oder Berlin kommen. In den 90er Jahren, in der ersten Phase der Professionalisierung des Designmanagements in Europa, waren die kulturellen Differenzen im Produktdesign ein großes Thema. Die USA haben damals viel für den europäischen Markt entworfen und man wollte den Link zum Konsumenten nicht verlieren. Das hat sich vollständig überholt. Nationen lösen sich längst im Cyberspace auf. Die globale Angleichung der Konsumpräferenzen gilt auch für das Digitale. Gleichzeitig ermöglicht die Digitalität von Produkten und Services die totale Vielfalt von hoch individualisierten Schnittstellen und Usererfahrungen.
Hanke: Es gibt höchstens unterschiedliche Gewohnheiten. Themen und Inhalte muss man anpassen, aber nicht die Produktstrukturen. Kontexte sind wichtiger als Länderunterschiede. Und Sprache ist natürlich ein Thema: Die Swisscom hat zum Beispiel eine eigene schweizerdeutsche TV-App-Sprachsteuerung, weil Siri und Cortana in der Schweiz nicht funktionieren. In Zürich gibt es ein Unternehmen, Spitch, das die ganzen schweizerdeutschen Voice-Interfaces entwickelt. Ansonsten ist es weniger interessant, für welches Land man gestaltet sondern mit welcher Haltung. Mein Lieblingskommentar beim NZZ-Launch war: Das ist Schweizer Präzision! – Gemacht in Deutschland ...
Thesen: Ja, es geht letztendlich nur um die Haltung, die in Deutschland eben vor allem durch Ulm geprägt wurde.
Hanke: Mich würde ja ein Ulm-Plus interessieren. Über Willy Fleckhaus, der für mich immer wahnsinnig wichtig war, habe ich gelesen, dass er sich wohl von Max Bill die Ordnung abgeschaut habe und von Alexey Brodovitsch aus den USA die Fantasie. Das wünsche ich mir für die Zukunft: Das wir das Systematische, das wir so gut können, mit Fantasie paaren.
Interview erschienen in designreport 6/2017
Text: Martin Krauter. Illustrationen: Anni von Bergen

Eine andere Denke
Lassen sich klassische deutsche Designwerte wie Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Funktionalität und ein systematischer Ansatz auf das digitale Produktdesign übertragen? Spielt die Nationalität in der digitalen Äraüberhaupt noch eine Rolle? Über diese und andere Fragen diskutiert der designreport mit Christian Hanke, Kreativdirektor bei Edenspiekermann, und Philipp Thesen, Leiter Design der Deutschen Telekom.
Designreport: Ich denke, jeder hat eine Vorstellung davon, was deutsches Produktdesign ist. Sofort fallen einem Klassikermarken wie Braun oder BMW ein. Wir sind hier bei einem Unternehmen zu Gast, das schwerpunktmäßig Serviceleistungen anbietet. Philipp, werden die Telekom-Produkte im Ausland überhaupt als deutsch wahrgenommen?
Philipp Thesen: Das ist ganz unterschiedlich. Deutsches Design ist ja international sehr positiv konnotiert. Vor einigen Jahren, als wir die Designsprache der Telekom-Produkte, auch unserer gesamten Digital Experience, definiert haben, stand die Frage im Raum, ob es dabei spezifisch deutsche Aspekte gibt. Wir sind ein Unternehmen, das seine Produkte in 30 Ländern vertreibt, zu dessen Markenidentität es aber auch gehört, ursprünglich aus Deutschland zu kommen. Ich hatte schon immer ein Interesse an deutschem Design und muss zugeben, dass ich lange Zeit dachte, ein gewisser Ulmer Funktionalismus wäre global üblich. Mein Studium im Ausland hat mir dann gezeigt, dass das nicht überall so verstanden wird.. Internationale Designer schätzen das grundsätzlich Systemhafte, das Nachhaltigkeitsdenken und ein Qualitätsanspruch, der nicht als Luxus verstanden wird, als deutsche Attribute –diese Werte haben durch den internationalen Einfluss der Ulmer Hochschule durchaus etwas Universelles bekommen.
Christian Hanke: Als wir 2015 unser Büro in Los Angeles eröffnet haben, war es ein wichtiges Verkaufsargument, dass wir eine europäische beziehungsweise deutsche Agentur sind – wie ein Gütesiegel. Das liegt aber auch daran, dass Erik (Spiekermann), der als Designer eben diese klassischen Attribute vertritt, dort sehr bekannt ist.
Thesen: Andererseits gibt es viele profilierte Designer aus Deutschland, die hinter ihren Arbeiten verschwinden, anders als beispielsweise in Italien oder Frankreich.
Hanke: Findest Du, dass das etwas Deutsches ist?
Thesen: Ich weiß nicht, aber ich habe in Mailand und Helsinki studiert. In Italien betreiben die Designer einen gewissen Personenkult, in Skandinavien nehmen sich die Leute zwar sehr zurück, aber auch da ist das Autorendesign wichtiger als bei uns. Hier wie dort gibt es starke Design-Unternehmen, deren Ursprung im Handwerklichen liegen. In Deutschland sind die Design-Hochburen eher in der Industrie zu finden und erst neuerdings fängt es an, dass Chief Design Officers wie Gorden Wagener von Mercedes-Benz auch endlich in der Öffentlichkeit präsent sind. Oft ist der deutsche Designer aber immer noch ein dienender, unsichtbarer Geist, der Dinge entwirft, die international gern benutzt werden, deren Autorenschaft aber eher im Verborgenen bleibt.
Designreport: In welcher Form sind denn die Designqualitäten, die ihr, Philipp, damals für euch als typisch deutsch herausgearbeitet habt, in die digitalen Produkte der Telekom übersetzt worden. Lässt sich das konkretisieren?
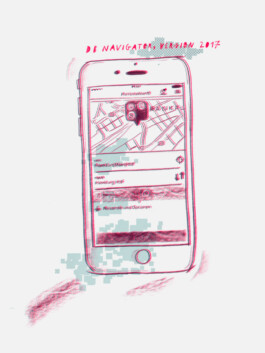
Thesen: Wir haben schon ganz früh sehr funktional gedacht. Man muss dabei sehen, dass sich die Erkenntnis, dass das Thema Digital Experience vor allem auch Hardware-Software-Serviceinnovationen betrifft, in der Breite erst seit ein paar Jahren durchsetzt. Vorher ging es im Digitalen in erster Linie um Websites und Apps, um Entertainment. Und das Funktionale waren oft eher funktionalistische Zitate, wie anfangs bei den Oberflächen von Apple-Produkten, die stilistisch zwar an Dieter Rams erinnerten aber noch gar nicht in dessen Sinne gestaltet waren.
Designreport: Das Klassikerbeispiel: der Taschenrechner von Dietrich Lubs, dessen Optik einfach kopiert wurde ... Das hat doch sicher auch damit zu tun, dass digitale Produkte naturgemäß weniger greifbar sind als Hardware-Produkte, oder?
Hanke: Ist das wirklich so? Ich glaube, wir mussten über die Jahre nur erst einmal lernen, was eine digitale Haptik oder eine digitale Materialität ist. Wir waren anfangs einfach noch unbeholfen.
Thesen: Genau das meine ich. Hinter diesen Zitaten steckte ja auch eine gewisse Hilflosigkeit.
Hanke: Beziehungsweise die Notwendigkeit, für den Nutzer eine Brücke zu schlagen. Darum sind Icons wie die Diskette als Symbol fürs Speichern entstanden. Mittlerweile ist das alles nicht mehr neu und wir können reifer gestalten.
Thesen: Das Digitale ist ja ein völlig neuer Erfahrungsraum, auch im wortwörtlichen Sinne. Es ist kein Zufall, dass die meisten digitalen Anwendungen zu Beginn eher von Industriedesignern gemacht wurden. Auch wir haben vor 10 Jahren erst mal vor allem Industriedesigner eingestellt, weil die räumlicher denken können und sich damit besser in Navigationsstrukturen bewegen können. Damit hatten Grafikdesigner früher erst mal Schwierigkeiten, die waren mehr auf die Oberfläche konzentriert.
Designreport: Auch die Bedeutung von Designklassikern lässt sich mit Unsicherheit in Verbindung bringen: Wenn Verbraucher nicht genau wissen, was gut ist, greifen sie auf Klassiker zurück. Lässt sich das auf das Digitale übertragen? Kann Bewährtes zum Designklassiker werden?
Hanke: Nein, die Denke ist anders. Sicherlich gibt es Metaphern oder auch eine bestimmte Ästhetik, die einen entsprechenden Zeitgeist ausstrahlt. Wikipedia zum Beispiel wird im Großen und Ganzen wohl immer so bleiben, wie es ist. Aber wird es deswegen zum Designklassiker? Oder gehören solche Seiten ins Museum?
Thesen: Nein, außer vielleicht die erste Spiegel-Online-Seite! (Lachen) Aber genau das ist ein wichtiger Punkt: Die Digitalität verändert das Verhältnis des Designers zu seinem Werk und damit sein Selbstverständnis fundamental. Lange Zeit haben Designer davon geträumt, Dinge zu entwerfen, die im Museum landen, die ihr eigenes Leben überdauern – als Ikonen für die Nachwelt eben. Das kann es bei Produkten, die man aufgrund von Nutzeranalysen und Iterationen gefühlte 600 mal am Tag relauncht, nicht geben. Selbst wenn man bestimmte digitale Anwendungen im Kontext ihrer Zeit als herausragend beurteilen kann.
Hanke: IOS 1, das ist auch so eine Zeitkapsel!
Thesen: Ja, oder wichtige Paradigmenwechsel wie Apple’s Lisa – die Geburtsstunde des Graphical User Interface! Aber niemand würde darauf aus Unsicherheit zurückgreifen wollen, so wie man etwa einen Eames Chair kauft, weil man damit nichts falsch machen kann. Vielleicht tritt das digitale Design in die Fußstapfen des unsichtbaren Industriedesigners.

Hanke: Ein bisschen anders ist das vielleicht im digitalen Editorial Design, weil es dort, wo es ums Erzählen geht, expressiver zugehen darf. Von so etwas wie „experimenteller Navigation“ zu reden, ist allerdings Schwachsinn. Das liest man vielleicht in Bachelor-Arbeiten, aber ansonsten muss man sich schon fragen, wo bitte genau dafür die Nische sein soll! (Lachen)
Krautter: Gibt es dann vielleicht bestimmte Gestaltungsprinzipien, die sich im Digitalen zu so etwas wie Klassikern entwickelt haben?
Hanke: Auf jeden Fall. Es gibt ganz starke Konventionen. (Beispiele wären an dieser Stelle wichtig, sind aber leider nicht verständlich … Übereinandersprechen, Gesprächsstelle: ca. 00:25:00 h)
Thesen: Und das wird weitergehen, vieles wird dazukommen. Es wird neue Interaktionsformen geben – Sprache, Gesten, Predictive Interfaces, die für die User Experience immer wichtiger werden. Und auch da werden sich wieder Klassiker herausbilden.
Krautter: Kann man sich in einem so beweglichen Umfeld überhaupt vorstellen, dass jemand mal zehn Pflöcke einhaut und so wie Dieter Rams mit zehn Thesen festlegt, was gut ist?
Hanke: Aber diese Thesen beziehen sich ja nicht auf einen spezifischen Designbereich!
Thesen: Es geht dabei doch vielmehr um einen Berufsethos, um eine Haltung.
Hanke: Und es steckt einiges drin, was ziemlich deutsch ist. Ich habe im Vorfeld ein paar nichtdeutsche Kollegen nach ihren Vorstellungen von deutschem Design gefragt. In der Hoffnung, ein paar Antworten jenseits der üblichen Klischees zu finden.
Thesen: Klischees sind ja auch nur verdichtete Information ...
Hanke (lacht): Genau! Eine Kollegin aus Slowenien meinte: Germanness is scheduled fun. Aber als Qualität! Ein anderer Kollege sagte, Künstler und Ingenieur in einer Person zu sein, wäre typisch. So ähnlich hat es auch Erik mal für unsere Agentur ausgedrückt: Wir wollen Dinge machen, die nützlich und schön sind, nie nur nützlich und nie nur schön.
Krautter: Aber nichtsdestotrotz unterschieden sich doch die Designprozesse im Digitalen beispielsweise von denen im klassischem Produktdesign. Von einem Stuhl gibt es ein halbes Jahr später kein neues Update, das ist ein abgeschlossenes Produkt.
Thesen: Wenn man aber an die Möglichkeiten von Technologien wie 3-D-Druck denkt, sieht das vielleicht schon anders aus. Durch die Digitalisierung wird die Produktwelt komplexer und immer individueller, deswegen ist das Thema Designmethoden und -prozesse, das seinen Ursprung mal im Technologie-Boom der 1960er Jahre hatte, zur Zeit ja auch wieder so aktuell.
Hanke: Im Vergleich zwischen Print- und Online-Journalismus spricht man von finiten und infiniten Produkten. Die einen denken in Deadlines, für die anderen fängt die Arbeit nach Veröffentlichung erst richtig an – dann wenn die Menschen sich einbringen, mitreden wollen.
Krautter: So offen zu arbeiten, erfordert von Produktdesignern ein großes Umdenken.
Thesen: Das ist eine Frage der Motivation, die hinter der Arbeit steckt. Es gibt explorative Designer, die die Welt erschließen wollen, und andere, die festlegen wollen, wie die Welt zu sein hat. Das sind zumindest zwei Archetypen, die mir immer wieder begegnen. (Lachen)
Krautter: Auch eine gewisse »Ich weiß, was gut für dich ist«-Haltung gilt gern als typisch deutsch. Wie sieht das im UX-Design aus?
Hanke: Autoritäres Design? Funktioniert da nicht oder wird einfach als schlechtes Design wahrgenommen.
Thesen: Im UX-Design steht der Nutzer im Mittelpunkt. Designer sind hier eher Moderatoren zwischen Lebenswelt und Technologie. Mit einem autoritären Gestus kommt man da nicht weit.
Krautter: Wie passt dann dazu, dass Deutschland ausgerechnet in Sachen Service-Design als Spätzünder gilt?
Thesen: Also ich empfinde Deutschland überhaupt nicht als Servicewüste. Ich kenne nicht wenige Leute im europäischen Ausland, die die App der Deutschen Bahn nutzen, um Zugverbindungen im eigenen Land herauszusuchen – weil die so zuverlässig ist. Und es gibt viele solcher Beispiele für hervorragendes Service-Design aus Deutschland.
Hanke: Ich glaube, diese Wahrnehmung hat viel mit dem sehr deutschen Bedürfnis zu tun, alles zu kritisieren. Wenn wir ein digitales Produkt verändern, das viele benutzen, wird grundsätzlich erst einmal gemeckert. Beim Relaunch der NZZ in der Schweiz standen in den Kommentare eher Sätze wie: Klasse, das Blau sieht so wertig aus. Das ist Schweizer Präzision!
Thesen: Und das Thema Servicewüste ist doch auch eins aus den 90ern.
Hanke: Der Begriff hat etwas mit den damaligen behördenähnlichen Strukturen zu tun, mit Monopolstellung – man musste sich nicht so schnell dem Wettbewerb stellen. Viel interessanter ist es aber in die Zukunft zu schauen und zu fragen, was sich daraus lernen lässt. Werden Rückschlüsse gezogen? Hilft das die Angebote zu verbessern? Viel ließe sich schon verändern, wenn die Unternehmen konsequenter die Menschen in die Entstehungsprozesse einbeziehen würden, die bei ihnen mit den Nutzern der Produkte im Kontakt stehen. Partizipation: Wenn man mehr mit den Leuten und nicht über sie hinweg gestalten würde, müssten wir über das Thema Servicewüste nicht länger reden.

Krautter, Martin: Eine andere Denke
designreport, Ausgabe 6/2017 (S. 48 – 52)
Thesen: Das Design muss da noch viel stärker eine vermittelnde Rolle zwischen Mensch, Technologie und Business-Interessen einnehmen. Das setzt voraus, dass sie sich interdisziplinär aufstellt und über ein reiches vielfältiges kulturelles Wissen verfügt. Da stößt der deutsche Horizont sehr schnell an seine Grenzen.
Designreport: Stichwort Designthinking – wie kompatibel ist die Methodik mit deutschen Unternehmenskulturen?
Hanke: Wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich hatte mal eine Art Heureka-Moment, als mich jemand in diesem Zusammenhang an Maslow und seine Bedürfnispyramide erinnerte. Erst an der Spitze der Pyramide geht es um Selbstverwirklichung. Das heißt solange ein Mitarbeiter nicht weiß, wie sicher sein Job ist, welche Rolle er in der Organisation hat, nie die Erfahrung gemacht hat, gemeinsam mit Kollegen etwas zu bewirken, solange also die sogenannten Defizitbedürfnisse nicht erfüllt sind, wird er auch nicht über Innovationen nachdenken können. Da braucht man dann auch keine Workshops mit bunten Post-its zu machen. Das funktioniert nicht.
Designreport: Gut, aber das ist jetzt kein spezifisch deutsches Problem. Oder ist das vielleicht ein Problem des Mittelstands, der ja hierzulande besonders stark ist?
Thesen: Es geht eher um die Frage, wie professionell mit dem Thema Innovation umgegangen wird, und auch wie wirkmächtig das Design in einer Organisation ist. Diese Arbeit kostet viel Geld und Kraft, darüber muss man sich im Klaren sein. Sich über Design und Innovationen Gedanken zu machen, ist für niemanden in der Organisation ein Hobby, das macht keiner nebenbei.
Designreport: Muss eurer Meinung nach der Mittelstand in Deutschland digitaler werden?
Hanke: Nein. Jeder muss für sich klären, wo die Geschäftsfelder der Zukunft liegen und welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt. Die größte Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass man in zwei Betriebssystem gleichzeitig denken muss. Kein Unternehmen kann es sich leisten, von einem zum anderen Moment nur noch Digitales zu machen, was auch immer das heißen mag.
Thesen: Auch Innovationen lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen einführen. Bei einem Unternehmen wie der Telekom ist es ein großes Risiko IT-Strukturen einfach umzugestalten, mit Geschäftsmodellen oder Tarifen zu experimentieren. Da geht es um Milliardenbeträge. Das ist ein grundsätzliches Problem großer Strukturen, das aber langfristig gelöst werden muss. Die einzige Antwort auf disruptive Geschäftsmodelle wie Uber etc. ist es, selbst überzeugende Angebote zu schaffen.
Designreport: Gibt es international erfolgreiche Digitalprodukte, die als deutsch wahrgenommen werden?
Thesen: Wenn Apps oder andere digitale Produkte erfolgreich sind, spielt es keine Rolle, ob sie aus Tel Aviv, Mountain View oder Berlin kommen. In den 90er Jahren, in der ersten Phase der Professionalisierung des Designmanagements in Europa, waren die kulturellen Differenzen im Produktdesign ein großes Thema. Die USA haben damals viel für den europäischen Markt entworfen und man wollte den Link zum Konsumenten nicht verlieren. Das hat sich vollständig überholt. Nationen lösen sich längst im Cyberspace auf. Die globale Angleichung der Konsumpräferenzen gilt auch für das Digitale. Gleichzeitig ermöglicht die Digitalität von Produkten und Services die totale Vielfalt von hoch individualisierten Schnittstellen und Usererfahrungen.
Hanke: Es gibt höchstens unterschiedliche Gewohnheiten. Themen und Inhalte muss man anpassen, aber nicht die Produktstrukturen. Kontexte sind wichtiger als Länderunterschiede. Und Sprache ist natürlich ein Thema: Die Swisscom hat zum Beispiel eine eigene schweizerdeutsche TV-App-Sprachsteuerung, weil Siri und Cortana in der Schweiz nicht funktionieren. In Zürich gibt es ein Unternehmen, Spitch, das die ganzen schweizerdeutschen Voice-Interfaces entwickelt. Ansonsten ist es weniger interessant, für welches Land man gestaltet sondern mit welcher Haltung. Mein Lieblingskommentar beim NZZ-Launch war: Das ist Schweizer Präzision! – Gemacht in Deutschland ...
Thesen: Ja, es geht letztendlich nur um die Haltung, die in Deutschland eben vor allem durch Ulm geprägt wurde.
Hanke: Mich würde ja ein Ulm-Plus interessieren. Über Willy Fleckhaus, der für mich immer wahnsinnig wichtig war, habe ich gelesen, dass er sich wohl von Max Bill die Ordnung abgeschaut habe und von Alexey Brodovitsch aus den USA die Fantasie. Das wünsche ich mir für die Zukunft: Das wir das Systematische, das wir so gut können, mit Fantasie paaren.
Interview erschienen in designreport 6/2017
Text: Martin Krauter. Illustrationen: Anni von Bergen